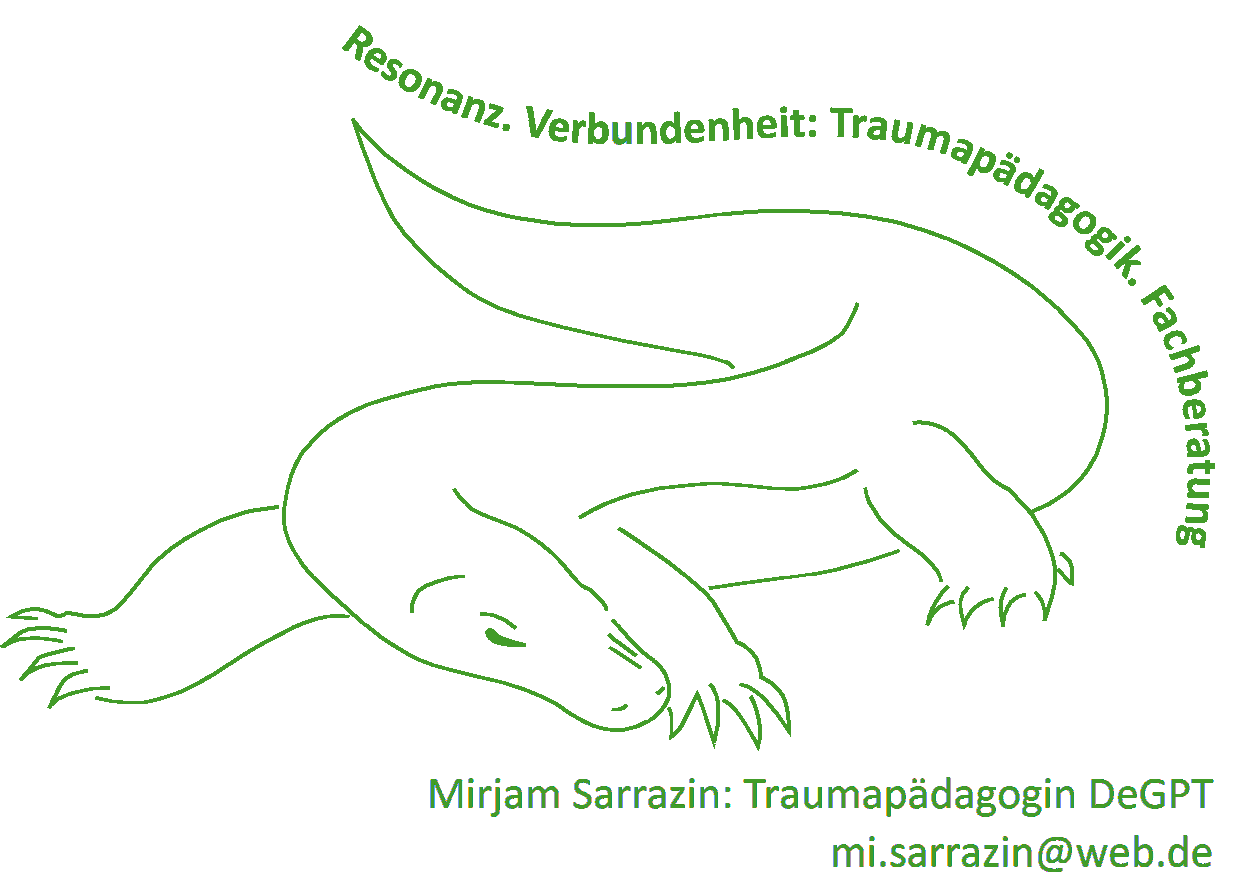Abends fängt es an zu schneien. Die Welt wird leise und meine laut. Unerträglich. Unverändert. Es ist nie wieder anders geworden. Seitdem es damals geschneit hat. Es gibt das Leben davor. Und das Leben danach. Das, was davon übrigblieb. Und dazwischen Schnee. Und dieser Lärm. Der ist geblieben. Als würde er all die Worte, die ich nicht sage, nicht denke, nicht fühle stellvertretend in meinen Ohren inszenieren. Unbarmherzig.
Es gab auch vorher Schnee. Ohne Lärm. Und das macht einen wesentlichen Unterschied. Meinen Unterschied. Alles scheint wie immer. Und das ist das tragische. Es ist nie wieder, wie es war. Draußen lachen jetzt Leute. Ziehen mit weißen Sneakern Spuren durch die dünne Schicht auf dem Fußweg. Ziehen weiter. Durch diesen Vorhang aus Schnee und Stille und Lärm.
Leute kommen aus dem Mehrfamilienhaus gegenüber. Zwei Große. Zwei Kleine. Als würden sie diese Welt das erste Mal betreten. Staunend. Öffnen die Münder und recken sie den Flocken entgegen. Drehen sich. Händchenhaltend. Kreischend. Und da ist er wieder, dieser Ton in meinen Ohren.
Ich stehe am Fenster, und zwischen der Stille und mir liegt der Lärm. Liegt der Schnee. Liegt die Panik, die in mir hochkriecht. Zusammen mit der Kälte. Draußen der Schnee, hier die Heizung direkt an meinen Beinen, und ich erfriere. Friere ein. Und das ist ja vielleicht auch der richtige Begriff für meinen Zustand. Früher war Sommer. Damals. Davor. Jetzt ist Winter. Symbolisch. Und wenn es schneit, wird es laut. Da hilft nichts. Hilft ja nichts.
Ich esse dagegen an. Dinge, ich nicht vertrage. Rosinen zum Beispiel. Ich bekomme Bauchschmerzen und Durchfall und verbringe viel Zeit auf dem Klo. Vor der Heizung. Hier ist es warm. Mein Bad ist so klein, dass ich vom Klo aus den Wasserhahn aufdrehen und mit etwas Geschick beide Füße in die Duschwanne stellen kann. Ich könnte meine Hände und Füße waschen und gleichzeitig pinkeln. Ich versuche das nicht. Ich lasse den Wasserhahn laufen, weil das Geräusch den Lärm übertönt. Ich drehe die Heizung hoch, weil sie dann gluckert und dieses Geräusch mich beruhigt, und es noch wärmer wird.
In meinem Bad gibt es kein Fenster, und ich sehe keinen Schnee. Und fühle ihn nicht. Ich schalte ihn aus. Mit dem Lichtschalter direkt neben dem Spiegel über dem Waschbecken. Dafür muss ich aufstehen vom Klo. Es fehlen vielleicht sechs Zentimeter, aber die sind erheblich. Ich schalte die Deckenlampe aus und in meinem Kopf den Schnee. So mache ich das immer mit diesem Schalter. Ich habe einen Leuchtstern draufgeklebt. Weil es magisch ist, was dieser Schalter kann. Alles ausschalten. Im Bad ist es warm. Und überall sonst Winter.
Dunkel ist es hier jetzt. Und immer noch laut. Davon habe ich jetzt die ganze Nacht etwas. Ich schlafe nicht. Ich tue nichts und doch ganz viel, und das meiste hat mit Kämpfen zu tun.
So ist das mit mir. Seitdem.
Irgendwann werde ich den Schalter mit nach draußen nehmen. Ohne ihn abmontieren zu müssen. Ich werde das Badezimmer und seine Wärme nicht mehr brauchen. Ich werde das in mir haben. So hat mir das jemand erklärt, der Ahnung hat von diesem Zustand, in dem Leben ein Vorher und ein Nachher hat, von dem dazwischen. Der wurde ganz eifrig, als ich meinen Badezimmerschalter erwähnte.
„Da haben Sie sich aber wirklich etwas Nützliches ausgedacht“, hat er mir gesagt, sich aufrecht hingesetzt und um diese fast unbemerkten Millimeter mit seinem Oberkörper auf mich zubewegt. Ich mochte das nicht. Ich musste in der folgenden Nacht diese Euphorie mit meinem Badezimmerschalter ausschalten. Aber die Unruhe blieb. Die Verunsicherung. Ich bin nicht mehr wieder zu ihm gegangen.
Trotzdem sind die Worte noch da. Dieses Bild. Ich mit dem Badezimmerschalter irgendwo draußen unterwegs. Und dann schalte ich alles aus, was ich nicht brauche. Magisch. Klick.
Es hat aufgehört zu schneien.
© Mirjam Sarrazin