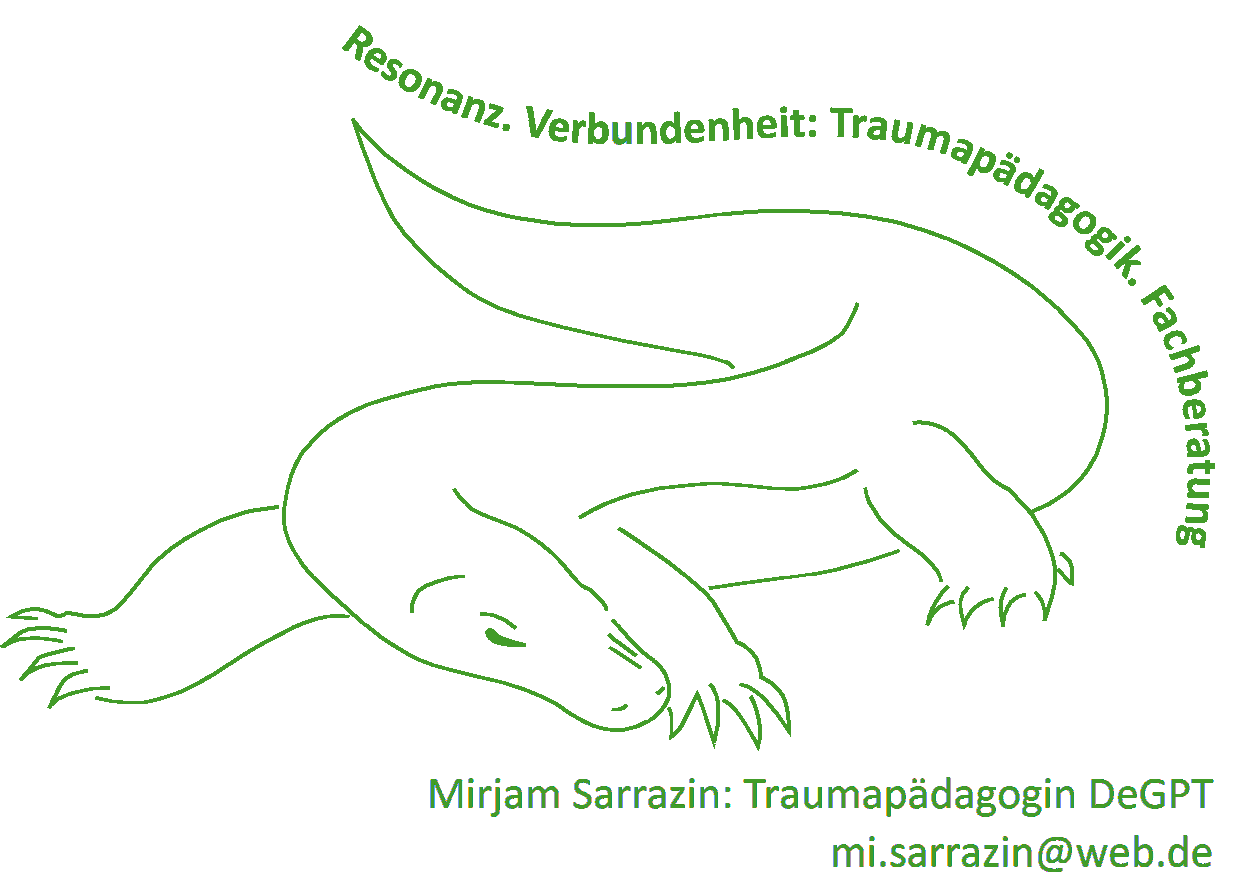Jetzt ist es wieder soweit. Jetzt sitzen alle wieder um diesen Tisch. Außer zwei, die sich zurückhalten. Wie jedes Jahr. Sie sitzen hinten auf der Couch und werfen hin und wieder Kommentare aus drei Metern Entfernung rüber auf den Tisch und verfehlen die Bratensauce knapp. „Dieses Jahr ist sowieso Abstand angesagt“, haben sie schon zur Begrüßung lachend bekannt gegeben und sich zugegrinst. Wir sind fünf Generationen, nach oben und unten ausgedünnt, und das, was an diesen Ästen weit verzweigt ist, sind insbesondere die Vorannahmen, Gerüchte und Tratschereien. Und doch ist es wieder soweit, sitzen wir alle hier. Loben das Essen, die Kinder, den Baum und den Wein. Die Luft ist zum Schneiden dick, und nun wird das elektrische Messer für den Braten in Betrieb genommen.
„Ach, ist da was unterwegs?“, zwinkert mir jemand zu, weil ich den Wein ablehne und Wasser trinke. Und mir ist grummelig, übelig, ekelig. Und ich lächle, kaue Klöße. Das wertvollste an so einer Tradition ist ja das Essen. Zum Festhalten. Zum Themen finden. Zum Ablenken. Lachen wir also über Anekdoten zu verbrannter Ente, zu auseinanderfallenden Kartoffelklößen, zu ausverkauftem, frischem Rotkohl.
„Na, der im Glas tut’s ja auch“, sagt jemand mit rauer Stimme und kauend und kippt Wein hinterher.
Das Essen ist sicheres Terrain. Außer für die, die es zubereitet haben. Aber die halten sich zurück, lächeln. Halten her. „Jetzt lasst uns aber anstoßen“, sagen sie, und ihre Gläser schießen in die Höhe. Prosten auch in Richtung Couch.
Viele erwidern, trinken. Jemand trägt Maske. Von Beginn bis zum Ende. Isst nicht, trinkt nicht. War nie anders. Dieses Mal wirkt es grotesk. Wie ein Mahnmal.
Jemand möchte Lieder singen, und einige stimmen ein. Andere rennen alle sieben Minuten nach draußen zum Rauchen oder vielleicht auch anderes. Die von der Couch knutschen. Oder vielleicht auch mehr als das. In der Küche entsteht Frustration, weil der Kuchen nicht aufgegangen ist, und ein Kind schreit verloren unter dem Tisch. Jemand bringt diesen Sack. Jemand unscheinbares. Nie aufgefallenes. Jemand anonymes, pflichtbewusstes, redegewandtes, zurückhaltendes, freundliches. So eine Person, wie wir sie alle kennen. Von irgendwoher. Die meisten haben eine im nahen Umfeld. Wie wir diese hier. Die sich von ihrem Stuhl erhebt, diesen schlaffen Sack neben sich herzieht. Aus Jute. Alter, spröder Jute. Ihn ablegt. Direkt neben dem Sessel, der irgendwo im Raum zwischen der Couch und diesem gigantischen Tisch steht, an dem wir sitzen. Fast neben dem Weihnachtsbaum. Und sich wieder hinsetzt. Direkt neben mich. Links neben mich. Deshalb nur erlebe ich die Szene mit. Niemand anders am Tisch scheint es mitbekommen zu haben. Alle schneiden, kauen, lachen, trinken, gurgeln. Ich kenne diese Person. Jedes Jahr aufs Neue frage ich nach Wohlbefinden, Job und unserer familiären Verknüpfung. Und vergesse es im Anschluss wieder.
Dieses Mal frage ich nicht. Ich frage mich, was da gerade passiert ist. Frage nicht die Person, frage in mich hinein. Diese unscheinbare Person nimmt sich jetzt ein Stück Fleisch, zertrennt es geschickt auf dem Teller und isst einen Happen. Ohne zu Kleckern. Steigt ein in ein leichtes Gespräch, das irgendjemand an diesem Tisch führt.
Ich bin müde. Möchte nach Hause. Verstehe nicht, was wir hier machen. Welche freuen sich über meine Anwesenheit. Welche treffe ich gerne. Ich führe kurze Gespräche, die mir gefallen. Andere, die sich in meinem Magen festsetzen.
Und dann fragt jemand in die Runde und brummelt es eher in sich hinein: „Wasndasda?“ Es beschäftigt mich die ganze Zeit. Was ist das für ein Sack, der aussieht wie ein dahingeworfener alter Putzlappen? Neben dem Sessel. Beim Weihnachtsbaum. Jemand steht auf, packt das Stück Stoff und hält es in die Höhe. Es gibt eine Kordel oben und diese runde Bauchform unten. Und jemand sagt: „Vom Weihnachtsmann.“ Und lacht höhnisch. Jemand antwortet „Hohoho“ und jemand ext ein Glas Wein. Alle schauen zum Sack. Für einen kurzen Moment. Bis er wieder am Boden liegt, und alle weitermachen mit ihrem Abend.
„Mach ihn mal auf“, sagt da diese Person links neben mir plötzlich und strahlt so viel Zutrauen und Ruhe aus, dass mir warm wird im Bauch.
„Es ist alles drin, was du brauchst“, höre ich und stehe auf. Ich bin jetzt neugierig, gehe rüber zum Sessel, hocke mich vor diesen zerlumpten Sack, nehme ihn in die Hand. Er ist leicht. Er wirkt leer. Nur ein Stück Stoff mit einer Kordel. Ich suche den Knoten, ziehe ihn auf, wickele die Kordel behutsam ab und halte den Sack nun mit beiden Händen geöffnet vor mich hin. Vorsichtig. Es ist dunkel in ihm. Es duftet in ihm. Der modrige Geruch, den ich erwartet hatte, ist nicht da. „Alles drin, was ich brauche“, hallt es mir durch den Kopf. Was brauche ich?
Da unterbricht jemand meine Gedanken.
„Gibt’s da auch Geld in dem Sack? Viel Geld? Das würde ich wohl brauchen“, steht jemand plötzlich hinter mir, schaut mir über die Schulter. „Bestimmt“, sage ich und halte der Person den Sack hin „Bitteschön. Einfach ausprobieren.“
Ich sehe Unsicherheit auf dem Gesicht. „Och nö, lass mal. Mach du erstmal was. Ich schaue zu.“
Mein Blick fällt auf Oma am Tisch, und ich traue mich. „Oma!“, rufe ich rüber zu ihr. Oma hört nicht mehr gut. Ich stehe auf und gehe auf sie zu. Ich fasse sie an der Schulter: „Oma, da hinten ist ein Sack. Da ist alles drin, was wir brauchen. Komm doch mal mit.“ Oma sieht mich fragend an und schluckt das Stück Kartoffel herunter, am dem sie gekaut hat. Ich helfe Oma dabei aufzustehen und sich auf den Sessel neben den Sack zu setzen. „Schau, Oma.“ Ich hebe den labberigen Sack hoch und ihr vor die Augen. „Hier ist alles drin, was du brauchst. Was brauchst du?“
Oma sieht in die Ferne. Die ersten Witze kommen hinten vom Tisch. „Einen guten Schnaps braucht Oma. Wie immer.“ Lachen. Rufen. „Trockene Stiefel“, sagt Oma und hat etwas entdeckt weit in der Ferne. „Endlich trockene und warme Stiefel.“
Meine Wangen glühen und meine Finger verheddern sich im Beutelstoff, finden den Eingang nicht. „Warme, trockene Stiefel, Oma? Warte, ich hole sie dir heraus“, nicke ich Oma aufgeregt zu, entwirre meine Finger, den Sack und mein Herz und greife tief hinein. „Ganz unten, Oma. Ganz unten sind sie bestimmt.“ Und da habe ich sie gefunden. Ich ziehe sie heraus, und sie sind trocken und warm und passen perfekt.
„Meine Frau brauche ich.“ Mit Tränen in den Augen greift jemand nach dem Sack, nimmt ihn mir ab, lässt die Hand tief in ihn gleiten, beugt sich mit dem Kopf hinterher, will darin verschwinden. Verschwindet darin und kommt mit der Frau an der Hand wieder heraus. Ohne Blick für etwas anderes. Wiedergefunden.
Plötzlich sind einige um den Sack herum. Um Oma im Sessel, um mich. Sie wollen in den Sack greifen. Sie brauchen so viel. Wieder brauchen alle so viel, und ich gehe auf Abstand. Setze mich an den nun leeren Tisch, trinke mein Wasser, spüre diese Leere. „Verbündete brauche ich hier in dieser Gesellschaft“, denke ich und bahne mir den Weg zurück zum Sack. Keine Chance. Alle halten ihn gleichzeitig, alle wollen was ausprobieren, wollen was brauchen, tief aus ihm heraus etwas holen. „Ich brauche Mut“, höre ich jemanden sagen. „Für dieses Vorstellungsgespräch im Januar!“
Und jemand anderes antwortet: „Wir können das üben. Hier und jetzt. Das wirst du doch schaffen, das Gespräch.“
„Gebt mir den Sack mal. Ich brauche ein Taxi. Ich muss jetzt echt nach Hause“, ruft jemand anderes beschwipst und postwendend eine andere Stimme. „Na, aber wir wohnen ja nicht weit auseinander. Ich nehme dich mit.“
Und plötzlich tanzt die Luft in diesem Raum. Überall ist Bewegung. Alle wuseln. Um sich, in sich, um den Sack herum. Einige erzählen sich ihre Wünsche, ihre Geschichten, ihre Sorgen. Einige lachen miteinander. Vereinzelt sitzen welche stumm. Bei sich. Oma schnarcht auf dem Sessel. Mit warmen, trockenen Füßen. Entdeckt sie jemand, wird geflüstert. Vorübergehend. Bis sie im Strudel des Miteinanders wieder vergessen wird. Wie der Sack. Weit nach Mitternacht entdecke ich ihn sorgsam zusammen gelegt im Bücherregal. Zwischen den Reiseführern. Ich habe eine lange Weile auf dem Sessel neben Oma gesessen. Habe staunend dem Treiben zugesehen, Omas Atem gelauscht, bin eingenickt, und im Traum bin ich mit ihr Schlittschuh gelaufen auf dem kleinen See hinten im Wald.
Es ist jetzt leiser geworden. Einige sind gegangen. Hier und dort unterhalten sich noch welche. Auf dem Tisch liegen Karten. Einige kommen vom Rauchen wieder herein und suchen nach Wein. Die von der Couch sind nicht mehr zu sehen. Es ist Geselligkeit im Raum. „Gemütlich“, denke ich verwundert. „Weihnachtlich“, denke ich und frage mich, was es definiert.
Und dann höre ich, wie die Haustür unten im Treppenhaus ins Schloss fällt. Ich stehe auf, werfe einen Blick durch die Häkelgardinen raus auf die dunkle Straße und entdecke im Licht der Straßenlaternen die Konturen dieser Person. Über die Schulter winkt sie mir zu. „Tschüss. Bis nächstes Jahr“, flüstere ich.
© Mirjam Sarrazin