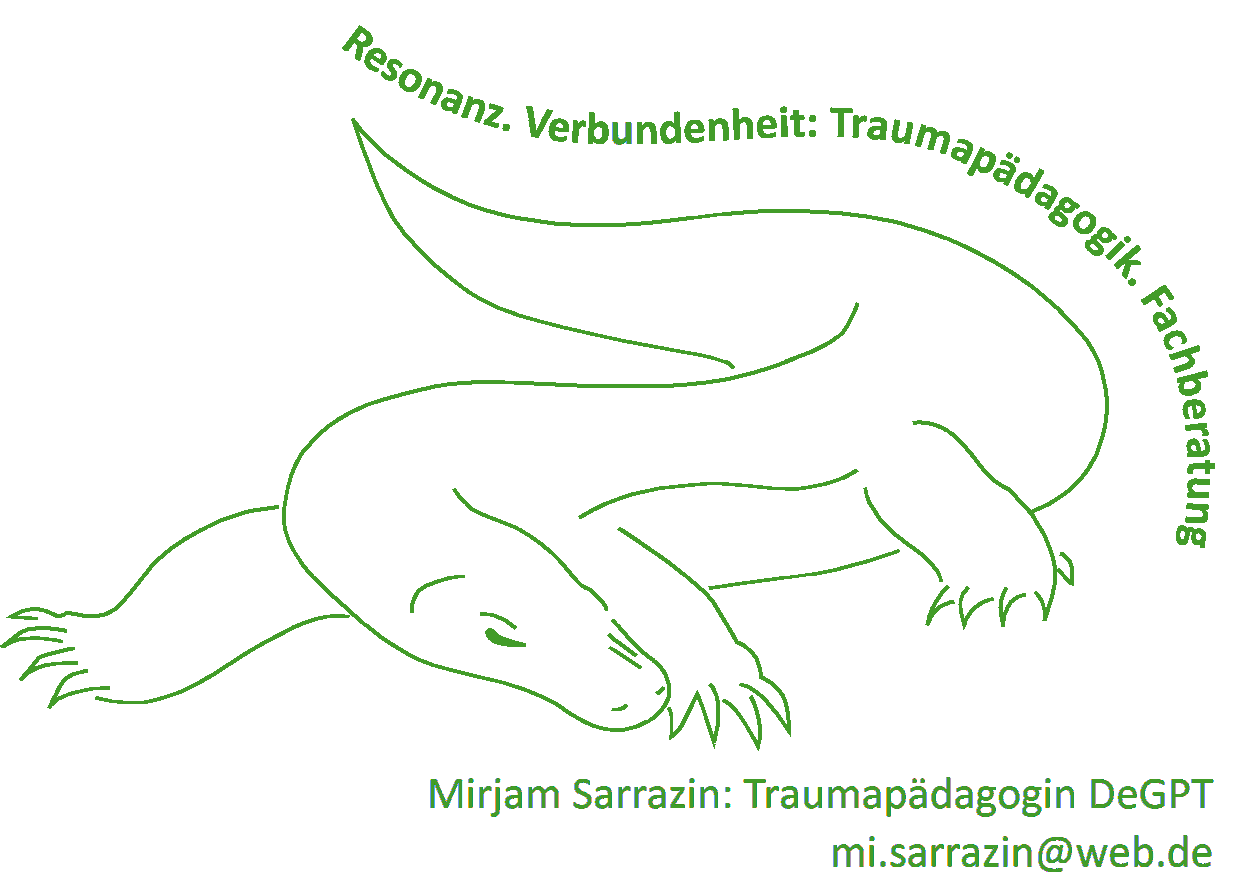Ich sitze am Fenster und schaue auf die Straße. Die dunkle, die trübe Straße. Es hat geregnet. Jetzt ist es trocken. Überall sind Pfützen, die nicht glitzern, da die Sonne fehlt.
Der Park ist leer. Vorhin lief ein Hund mit einem Mann vorbei. Hektisch. Einmal kurz Pipi machen. Dann wieder zurück in die Wärme der eigenen vier Wände. Irgendwo raus aus dem Park. Aus einem anderen Ausgang. Ich habe sie nicht mehr gesehen.
Jetzt sehe ich ein Kind und eine Frau. Das Kind trägt diese gelben Gummistiefel, die mit dem blauen Rand. Und einen gelben Regenmantel. Das Kind platscht in die Pfützen. Vermutlich lacht es. Ich sehe das Gesicht nicht, es ist verdeckt durch diese gelbe Kapuze, und das Kind springt seitlich zu mir. Ich kann es nicht hören. Mein Fenster ist geschlossen. Die Frau läuft hinterher. Sie schlendert, aber entspannt wirkt sie nicht. Sie friert, zieht den Mantel enger und bereut vielleicht, keine Mütze mitgenommen zu haben. Sie trägt einen Dutt und ein paar Strähnen hängen heraus. Wie Regenfäden.
Jetzt dreht das Kind sich zu ihr um, ruft etwas. Ich erkenne kurz das Gesicht und Grübchen, und es lacht tatsächlich, und ich höre es nicht. Ich kippe mein Fenster. Kälte strömt zu mir herein, und nun rennt das Kind los. Ein paar Meter rennt es, dann stoppt es. Natürlich. Alle stoppen immer am Kastanienbaum. Alle. Ich nicht. Ich schaue zu.
Das Kind steht jetzt dort, wo schon Erde ist und bückt sich bereits und zieht Kastanien zwischen braunen Kastanienblättern hervor. „Hab welche“, ruft es. Ich höre die Stimme und die Freude und schließe das Fenster. Jetzt regnet es wieder, und die Frau schaut kurz in den Himmel. Sie hat das Kind eingeholt und nimmt Kastanien entgegen.
Sie haben einen Beutel mitgebracht, den die Frau aus ihrer Manteltasche zieht, ihn öffnet und die Kastanien hineinfallen lässt. Das Kind bringt bereits die nächsten. Sie haben Glück. Es sind viele am Boden. Regen und Wind haben kräftig am Baum gerüttelt. Manche haben Pech. Manchmal kommen ganze Kindergartengruppen und suchen. Wenn ein Kind leer ausgeht, weint es und eine Begleitperson sagt: „Na, dann gehen wir rüber zum Spielplatz eine Runde Spielen. Das ist doch auch schön.“
Doch jetzt füllt sich der Beutel. Das Kind hüpft von einem Bein aufs andere, wirbelt herum und Blätter mit den gelben Stiefeln auf. Dabei fliegt Dreck durch die Gegend. Das Kind lacht, und ich kann es sehen, weil es frontal zu meinem Fenster steht in diesem Moment. Jetzt hebt es den Kopf, und es sieht mich. Unsere Blicke treffen sich. Spontan hebt es den rechten Arm, schüttelt die Hand, in der eine Kastanie steckt und lacht. Mir zu. Aus dem Augenwinkel erkenne ich, wie die Frau dem Blick folgt, kurz sucht, an meinem Fenster hängen bleibt. Mir zulächelt. Während es regnet.
Ich mache drei Schritte zurück, stoße beinahe gegen das Bettende, drehe mich, gehe in die Küche. Man braucht doch was Warmes an solchen Tagen. Ich lasse Wasser in den Kessel laufen. Entzünde das Gas, stelle den Kessel darauf und mich an das Küchenfenster. Schaue in den Hof, in dem Müll liegt, und eine schwarze Katze wohnt, die ich nicht entdecke. „Meine Güte, wo bist du mit deinem Kopf“, sage ich laut zu der fehlenden Katze und stelle das Gas aus. Ich war nicht einkaufen. Ich habe keinen Zucker. Immer noch nicht. Ich mag Tee nicht ohne Zucker. Ist ja auch nur heißes Wasser. Man müsste mal einkaufen.
Rastlos irre ich durch die Wohnung. Die sehr klein ist und immerhin zwei Fenster hat. Eines zum Hof und eines zur Straße. Das ist der Grund, warum ich sie mag. Solange es hell ist. Wenn es dunkel wird, ist es, als schauten mich zwei einäugige Ungeheuer an. Von zwei Seiten.
Ich habe mir ein Gerät zum Fensterputzen gekauft. Eines mit einer Seite zum Wischen und einer zum Abziehen. Das gab es im Angebot. Ich habe keinen Blick für Angebote, aber dieses ist mir aufgefallen. Es muss an dieser Fensterputzfirma liegen, die vor einigen Tagen die Schaufenster des Cafés an der Ecke geputzt hat. Ich habe die Leute beobachtet und im Lidl festgestellt, dass sie Spuren in mir hinterlassen haben. Vermutlich sind die Spuren vom Schaufenster zu mir hinüber gewandert, in mich hinein. Die Schaufenster sind jetzt sauber und ich bin voller Spuren. Das beschreibt mich gut.
Ich probiere es aus. Im Internet lese ich, dass es mit Spüli geht. Ich hantiere eine Weile herum und kriege es nicht streifenfrei hin. Man muss Geduld haben. Ich mache die Scheibe erneut nass, ziehe sie ab. Und klatsche das angebotene Gerät im Bad in die Duschwanne. Es landet unmittelbar neben dem Riss. Von irgendwem früher.
Ich verlasse das Bad, und es ist eine Tatsache, dass mein zweites Fenster fürs erste dreckig bleiben wird. Von der Tür aus werfe ich ihm einen trotzigen Blick zu, nähere mich dann und diesen Effekt mag ich. Die dreckige Fensterscheibe verschwindet, sobald ich vor ihr stehe und durch sie hindurchschaue. Auf die regennasse Straße, hin und wieder Menschen, überall parkende Autos. Niemand möchte unter dem Kastanienbaum parken. Ständig ist alles voll mit Blättern. Dort, wo das Kind mir zugelächelt hat. Nur der kleine Polo steht da oft. Der gehört einer Person aus meinem Haus. Einer dieser Nachbar*innen, die hier willkürlich ein- und wieder ausziehen. Zu jeder Tag- und Nachtzeit. Ich bleibe. Und schaue. Und jetzt wird es dunkel. Jeden Tag unvermittelt, wie es mir scheint. Oder extra dann, wenn ich es gar nicht brauche.
Man muss schneller sein. Und ich schlüpfe in meine Stiefel und verlasse die Wohnung. Natürlich werde ich nass. Und natürlich friere ich. Wer bei den Temperaturen keine Jacke trägt, friert. Ich habe keinen Tee, wenig zu essen, bin müde und erschöpft. Es ist nicht wärmer als zehn Grad und es regnet. Was soll man da anderes erwarten? Nass werden und frieren.
Ich gehe um den Block, schaue mir die Ritzen zwischen den Gehwegplatten an. Vor Hausnummer 27 entdecke ich einen winzigen Löwenzahn. Fast noch nicht als solcher erkennbar. Dass die das so können bei der Kälte. Hier so rumstehen und wachsen. Ich beschleunige meinen Schritt. Um nach Hause zu kommen. In meine Wohnung. Weil es dort warm sein wird. Trocken. Ich werde den nassen Pulli, die nasse Hose ausziehen, mich frisch anziehen. Mich in mein Bett legen, und es wird warm sein. Ich werde dankbar sein für Wärme und Trockenheit und die Dunkelheit vergessen. Ich trickse die Dunkelheit aus. Jeden Abend schlage ich ihr ein Schnippchen. Ich habe das im Griff. Auch heute.
Bis ich fast vor meiner Haustür stehe. Und der Kastanienbaum auf der anderen Straßenseite in meinem Blickfeld auftaucht, und der Polo dort parkt, und direkt hinter seinem rechten Vorderreifen dieser schwarze Katzenschwanz hervor lugt, am Boden. Und sich nicht bewegt. Regungslos dort liegt.
Da bleibe ich stehen. Und vergesse die Kälte. Während mein Körper zittert. Mir nebelig wird im Kopf. Ich suche mit der Hand nach dem Auto, das schräg vor mir parkt. Es ist rot. Mehr nehme ich nicht wahr. Schwarzer Katzenschwanz.
Ich hangele mich an diesem Auto vorbei, die rechte Hand stützend auf der Motorhaube. Überquere die nasse Straße, das rutschige Kastanienlaub. Freihändig. Der Polo ist jetzt direkt vor mir. Ich schaue hoch. In den Kastanienbaum. Wie groß er ist. Aus meinem Fenster wirkt er majestätisch. Diese Wirkung seiner Größe auf mich, hier, direkt unter ihm, habe ich nicht erwartet.
Drei Schritte gehe ich. Und blicke zu Boden. Die Luft anhaltend.
Und zucke zurück. Erschrecke. Der schwarze Katzenschwand verschwindet blitzschnell im Gebüsch. Neben dem Kastanienbaum, direkt vor mir. Zwei Schritte zwischen mir und dem Gebüsch. Einmal über den Bürgersteig. Ich schaue an die Stelle vor meinen Füßen. Leere. Gehwegplatten. Zwei zertretene Kastanienblätter. Eines gelb. Das andere braun, vertrocknet. Nass vom Regen, der fällt.
Ich bücke mich und hebe die Kastanie auf, die ich zwischen Bordstein und Poloreifen entdecke. In dieser Kuhle. Eine Kastanie. Ich fühle sie in der Hand. Glatte, runde Kastanie. Ich entdecke eine weitere. Hebe sie auf. Und noch eine.
Ich sammle Kastanien. Und stocke. Verharre. Mit Händen voller Kastanien. Nass. Eiskalt. „Die schwarze Katze lebt“, flüstere ich den Kastanien zu. In meinen Händen.
Ich drehe mich um, gehe zügig über die Straße, und jetzt ist es, als wären in mir verschiedene Leinwände aufgebaut, als schaute ich mehrere Vorführungen gleichzeitig. Eine Leinwand ist Kälte, eine ist ein leises Schaudern bei der Erinnerung an den Schreck, den die Katze mir eingejagt hat. Eine ist warmes Licht, das ich in meinem Fenster erahne, und eine ist Dunkelheit, die sich um mich zuzieht. Eine ist Irritation. Kastanien in meinen Händen, und die habe ich gesammelt. Eine ist auch Schatten, der hinter einem Fenster schnell zur Seite tritt.
Und während ich umständlich mit dem Schlüssel und den Kastanien an der Tür hantiere, blicke ich zu einer anderen Leinwand. Auf der ich meinen nassen Pullover ausziehe und die schwarze Katze hineinwickele. Zum Glück ist sie warm und weich, und ich hebe dieses Paket vorsichtig auf, drücke es an mich und wieder auf einer anderen Leinwand spricht eine Stimme. „Man muss sich ja auch kümmern.“ Und an dieser Leinwand bleibe ich erstaunlicherweise hängen.
Es ist nicht leicht, Paket, Kastanien und Schlüssel zu koordinieren, aber schließlich schaffe ich es, und endlich stehe ich in meiner Wohnung. Licht an mit dem Ellenbogen. Die Kastanien fallen mir aus den Händen. Kullern über den Boden. Machen hohle Geräusche, die ich nicht wahrnehmen würde. Weil ich schon beim Bett wäre, das Paket behutsam ablegen würde. So vorsichtig wie möglich. Bibbernd vor Kälte. Den nassen Pullover öffnen. Diesem suchenden Katzenblick begegnen würde. Mich kümmern. Die Katze versorgen. Ich hätte Katzenschmerzmittel und Futter. Ich hätte sowas gelernt und würde es gut machen. Nur kleine Verletzungen. Glück gehabt. Ein riesengroßes Glück gehabt. Dann viel Ruhe. Ausruhen. Wieder gut werden.
Schlafen. Umziehen. Hüpfen. Warm werden. Nicht denken. Die dunklen Fenster starren mich an wie einäugige Ungeheuer. Nicht hinschauen. Ich reibe mir die Füße. Im Stehen. Verliere kurz das Gleichgewicht. Dicke Socken. Zwei Paar übereinander. Verkrieche mich ins Bett. Tief unter die Bettdecke. Und die Wolldecke. In die Kissen. Mit den Löchern. Warm. Warm werden. Die Wärmflasche vom Nachmittag gibt noch Wärme ab.
Auf der Decke würde die schwarze Katze liegen. Ich strecke meine Füße unter sie. Warmer Knubbel. Ich liege und warte auf die Wärme. Dass der Körper ruhiger wird. Das Zittern abebbt. Ich das Handy wieder halten kann. Gegen die Angst und die Kälte und die Dunkelheit. Kurzes Schlafen. Aufschrecken. Handy. Lesen. Tagsüber Bücher. Nachts Handy. Dösen. Die dunklen Fenster. Aufgrund der Nische im Zimmer sehe ich sie nicht vom Bett aus, obwohl sie da sind. Menschen haben Vorhänge. Ich mag Vorhänge nicht. Man muss rausschauen und die Welt im Blick behalten.
Die schwarze Katze wäre jetzt aufgestanden. Sie würde nicht mehr auf der Decke liegen. Vielleicht wäre sie in der Küche und würde das Fleisch fressen, das ich ihr hingestellt hätte. Anschließend würde sie wiederkommen. Einen Knubbel machen. Und schlafen. Bei mir. Gemeinsam.
Jetzt wo mein Gehirn aufgewärmt ist, erinnere ich mich an die Kastanien auf dem Flurboden. Irgendwo in dieser Schublade in der Küche könnten Zahnstocher sein. Ich schlüpfe unter den Decken hervor, mache vier Schritte zum Flur, sammle die Kastanien ein, krame in der Küchenschublade, finde Zahnstocher. Und schaue ins ungeputzte Küchenfenster, durch das die Dunkelheit scheint. Mache meine Nase platt an ihm. Das glotzende Monster verschwindet, sobald ich es berühre. Manchmal muss man sich überwinden.
Ich drehe mich um, lege Kastanien und Zahnstocher auf das Bett. Neben den Fleck, wo die schwarze Katze gelegen hätte. Jetzt wären Katzenhaare da. Gehe zum sauberen Fenster mit den Streifen, mache meine Nase auch hier platt. Mein ganzes Gesicht. Die Lippen. Schiebe meine Zunge durch die gequetschten Lippen gegen die Scheibe.
Während die Katze sich putzen und erholen würde vom Schreck, auf der Fensterbank, würde ich erneut in die Küche gehen. Ich gehe in die Küche. Ich brauche etwas zum Stechen. Man muss kleine Löcher in die Kastanien machen. Dabei fällt mir eine Kastanie auf, die ich in der Ecke neben dem kleinen Schränkchen im Flur übersehen habe. Bücke mich, greife nach ihr und hinter ihr, hinter dem Schränkchen liegt Würfelzucker. Ich schiebe das Schränkchen zur Seite. Hebe drei kleine Würfel Zucker auf. Die müssen dort hingefallen sein, als mir eine Packung aufgerissen ist. Vor einiger Zeit. Nachdem ich eingekauft hatte.
Ich habe jetzt Zucker. Die Katze würde schnurren, während sie sich putzt, und ich würde in die Küche gehen und Teewasser aufsetzen.
Später trinke ich Tee. Der mir mit Zucker schmeckt. Und bastle ein Kastanienmännchen. In Katzenform. Bald wird es hell werden. Die ersten Nuancen zeichnen sich am Himmel ab.
Glück gehabt in dieser Nacht.
© Mirjam Sarrazin